Gesellschaftsvertrag

Gesellschaftsvertrag ist ein politisch-philosophischer Begriff, der auf die vielfältigen Ideen und Theorien verweist, die versuchen, der Herrschaft über Menschen eine rationale Grundlage (einen zugrunde liegenden Vertrag) zu geben.
Die folgende Untersuchung befasst sich mit den rationalen Grundlagen der Vertragstheorie des Gesellschaftsvertrages. Das Ziel besteht darin, erstmals in der Geschichte den geistigen Raum für eine konkreten Umsetzung "dieser Theorie" zu schaffen.
Laut dem Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung können drei denkbare Gesellschaftsformen wie folgt unterschieden werden:
- genossenschaftliche GesellschaftLaut dem Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung können drei denkbare Gesellschaftsformen wie folgt unterschieden werden:
- die Herrschafts-Gesellschaft und ständischer Gesellschaft
- liberaldemokratische Gesellschaft
Soziologisch wird zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft unterschieden und hieraus ergeben sich nachfolgende Erkenntnisse:
- Eine genossenschaftliche und weitgehend egalitäre Gemeinschaft, die sich durch größere Nähe und Verbundenheit der Menschen auszeichnet.
- Liberaldemokratischer Gesellschaft die sich durch eine stärker rationale (zweck-, nutzenorientierte) Begründung des Zusammenlebens auszeichnet.
Der Begriff der „Gesellschaft“ wird im Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung wie folgt definiert:
G. ist eine Sammelbezeichnung für unterschiedliche Formen zusammenlebender Gemeinschaften von Menschen, deren Verhältnis zueinander durch Normen, Konventionen und Gesetze bestimmt ist und die als solche eine G.-Struktur (G.-Gefüge) ergeben.
Soziologisch wird zwischen G. und Gemeinschaft unterschieden, wobei Letztere sich durch eine größere Nähe und Verbundenheit der Menschen und Erstere durch eine stärker rationale (zweck-, nutzenorientierte) Begründung des Zusammenlebens auszeichnet.
Es können folgende G.-Formen unterschieden werden: a) die genossenschaftliche G. als eine weitgehend egalitäre G. und b) die Herrschafts-G., in denen die Macht zwischen den gesellschaftlichen Gruppen ungleich verteilt ist, wobei zwischen ständischer G. (bei der der Stand des Individuums durch Geburt festgelegt ist: z. B. Adel, Geistlichkeit, Bürger, Unfreie) und c) liberaldemokratischer G. (auch: bürgerliche G., bei der die gesellschaftliche Durchlässigkeit individuelle Auf- und Abstiegsmöglichkeiten eröffnet) unterschieden wird.
Die typische "stärkere rationale (zweck-, nutzenorientierte) Begründung des Zusammenlebens" beinhaltet:
Im nachfolgend verlinkten Diskussion "Wahlsieger im Abseits: Schlag ins Gesicht der Wähler? | Links. Rechts. Mitte" wird die Frage gestellt "Was meint jemand, wenn er sagt 'liberale Demokratie'?
Der Philosoph und Autor Norbert Bolz legt die „drei rationalen Stützpfeiler", zu denen es laut Bolz „eigentlich keine vernünftige Alternative gibt", wie folgt dar:
Das ist einmal Demokratie, also die politische Form, wie wir zusammenleben, wie wir Macht organisieren, wie wir unser gesellschaftliches Leben politisch organisieren.
Das Zweite ist der Rechtsstaat, der Liberalismus ermöglicht. Also das ist das Fundament des Liberalismus.
Und das Dritte ist die Wirtschaftsform, der Kapitalismus.
Hier ist die Passage wortwörtlich:
Frage: „Ich weiß, was Demokratie ist, ich weiß, was Liberalismus ist, aber ich weiß nie ganz genau, was jemand meint, wenn er sagt ‚liberale Demokratie‘?
Norbert Bolz: "Auch dummes Zeug. Das ist ein Import aus Amerika. ‚Liberal democracy‘ benutzen gerne die Demokraten dort, weil sie beides sein wollen, obwohl ‚liberal‘ dort auch noch ein bisschen was anderes bedeutet, nämlich eigentlich links. Und im Grunde ist es ein Unsinn.
Das System, mit dem wir leben und mit dem wir gut leben und das wir nicht anders haben wollen, das hat drei Stützen: Das ist einmal Demokratie, also die politische Form, wie wir zusammenleben, wie wir Macht organisieren, wie wir unser gesellschaftliches Leben politisch organisieren. Das Zweite ist der Rechtsstaat, der Liberalismus ermöglicht. Also das ist das Fundament des Liberalismus. Und das Dritte ist die Wirtschaftsform, der Kapitalismus. Das Tolle an den letzten Jahrzehnten ist, dass alle Alternativen dazu, die bisher mal durchprobiert wurden, kollabiert sind. Und jeder, der halbwegs ehrlich ist, sagt: ‚Dazu gibt es eigentlich keine vernünftige Alternative, jedenfalls, wir wollen es nicht anders.‘ Insofern ist so ein Ausdruck wie ‚liberale Demokratie‘ einfach nur eine Zauberformel, mit der man Probleme verwischen will.“
Kritische Auseinandersetzung mit der zitierten Annahme:
Die Krux des Zustands des "Kapitalismus" als Wirtschaftsform wurde unter anderem im Werk "Endspiel des Kapitalismus: Wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen" von Norbert Häring aufgezeigt, nämlich wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzten, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umzusetzen. Der renommierte Wirtschaftsjournalist bietet in diesem Buch eine tiefgehende Analyse der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Landschaft und argumentiert, dass diese Entwicklungen zu einer weiteren Konzentration von Reichtum und Macht führen, während breite Bevölkerungsschichten benachteiligt werden.
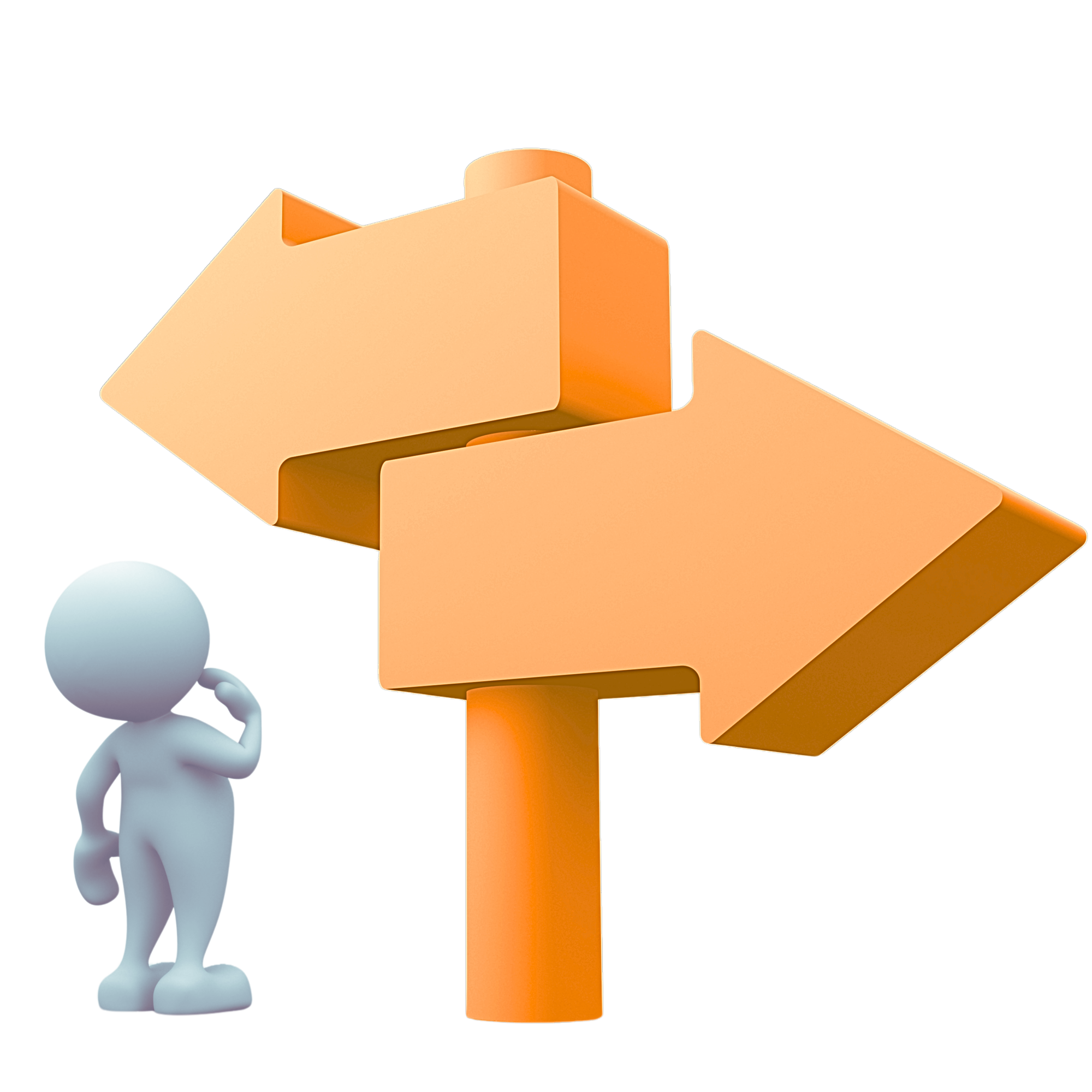
Zeit für ein neues System, das allen dient
und nicht einer kleinen Elite
Der Erfolg des westlichen Gesellschaftsmodells basiert auf drei wesentlichen Säulen:
- Freiheit als Grundlage individueller Entfaltung,
- Rechtsstaat als Garant für Stabilität und Gerechtigkeit, sowie
- marktwirtschaftlicher Wettbewerb als Motor für Innovation und Wohlstand.
Diese essenziellen Grundpfeiler bilden ein gemeinschaftliches Zusammenspiel, das den Menschen nicht nur die freie Entfaltung ihrer Kreativität ermöglicht, sondern auch die optimale Nutzung ihrer Talente und Fähigkeiten fördert. Durch dieses System können Einzelne von ihren Innovationen und unternehmerischen Initiativen profitieren, während gleichzeitig die gesamte Gemeinschaft durch technologischen Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum und steigenden Lebensstandard einen nachhaltigen Nutzen erfährt.
Der Grundgedanke, dass die Innovationskraft und unternehmerischen Initiativen der Einzelnen nicht nur innerhalb börsennotierter Konzernstrukturen oder durch "Venture-Capital"-Investments und der gleichen einen Anreiz bieten können, sondern eben auch innerhalb von Genossenschaften, die sich durch basisdemokratische Entscheidungsstrukturen und wirtschaftliche Partizipation bzw. Förderung ihrer Mitglieder auszeichnen.
Die Genossenschaft folgt der Genossenschaftsidee mit ihrem Prinzip der „Hilfe durch Selbsthilfe“.
Es werden nachfolgende Grundsätze hierzu vorgeschlagen:
- Freiwillige und offene Mitgliedschaft,
- demokratische Mitgliederkontrolle,
- ökonomische Partizipation der Mitglieder,
- Autonomie und Unabhängigkeit,
- Ausbildung, Fortbildung und Information,
- Kooperation mit anderen Genossenschaften,
- Vorsorge für die Gemeinschaft.
Im Gegensatz zum Prinzip der Profitmaximierung anderer Wirtschaftsunternehmen, ist das zentrale Leitmotiv die Nutzenmaximierung bei der Bereitstellung von wirtschaftlichen Erzeugnissen oder öffentlicher Daseinsvorsorge. In der Regel verfolgen Genossenschaften Ziele, die über jene reiner Wirtschaftsbetriebe hinausgehen und Werte sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung umfassen.
„Die Genossenschaft als Rechtsform ist urdemokratisch.“
– Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbandes: Die Tageszeitung, 29. Oktober 2019
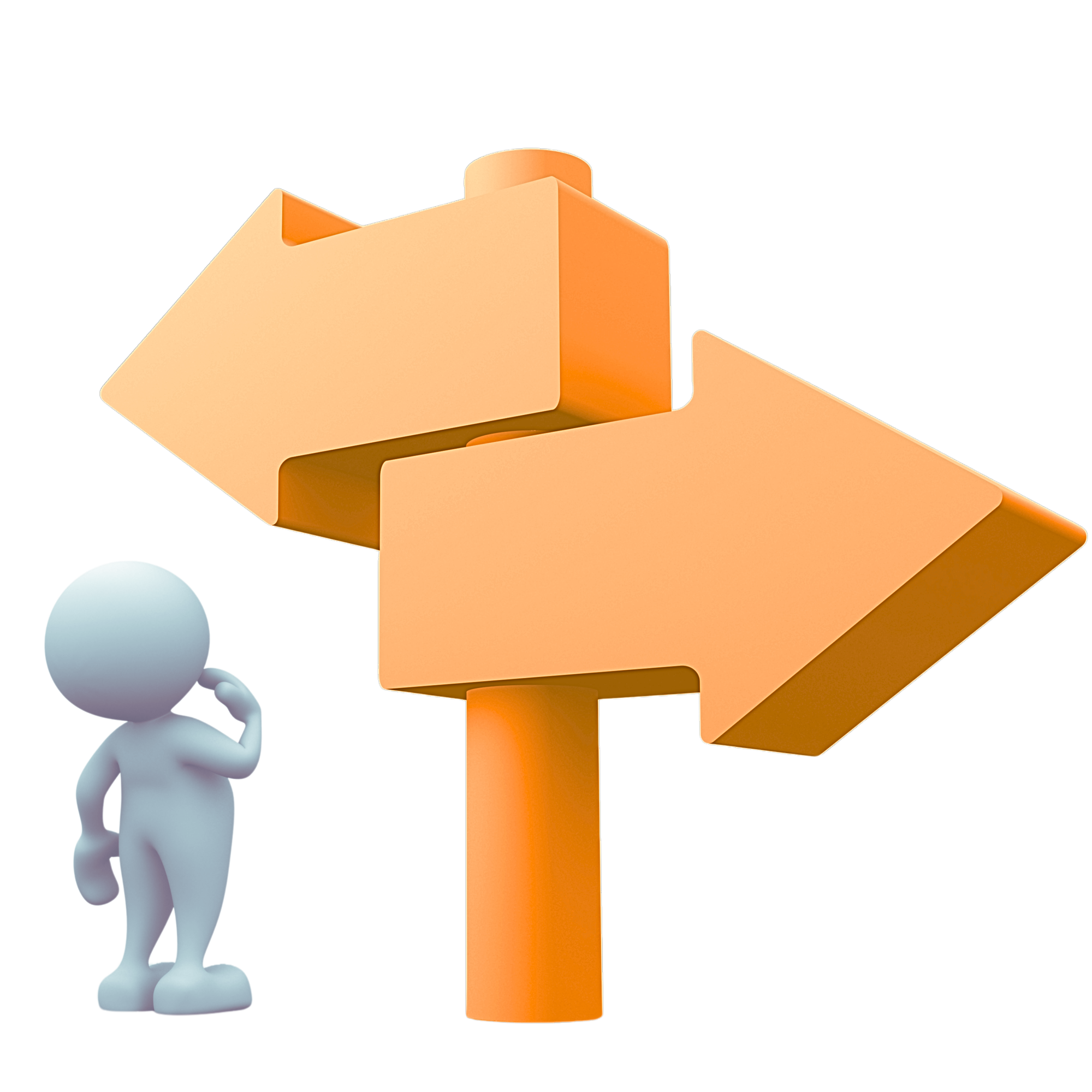
Zwischenfazit
Gemeinschaft oder Gesellschaft?
Wenn eine genossenschaftliche und weitgehend egalitäre Gemeinschaft, sich durch größere Nähe und Verbundenheit der Menschen auszeichnet und die liberaldemokratischer Gesellschaft PER DEFINITION eine hierarchische Herrschaftsordnung darstellt, die sich zweck-, nutzenorientierte Begründung des Zusammenlebens auszeichnet, dann ist die Verdinglichung und zweckmäßige Instrumentalisierung wesensimmanent und damit ist eine „liberaldemorkatische Gesellschaft“ als politische Organisationsform mit einem Universalanspruch der Menschenwürde UNVEREINBAR und das SCHEITERN der Umsetzungsversuche nur noch im seinem epischen Ausmaß zur Kenntnis zu nehmen und als NEGATIVES VORBILD festzustellen!
Rechtsstaatliche Adaption:
In der politischen Philosophie und Verfassungslehre kommt Rousseaus Konzept des „allgemeinen Willens“ (volonté générale) eine zentrale Bedeutung zu:
- „Durch seine Teilhabe am allgemeinen Willen verliert der Einzelne seine Willkür, und er erfährt, was er wahrhaft will, seine Freiheit, sein Eigentum und die gesetzliche Gleichheit.“
- Wahre Freiheit ist definiert als die Fähigkeit, im Einklang mit vernünftigen und gemeinschaftlichen Zielen zu handeln, statt nur der Willkür zu folgen. Der Schutz von Eigentum und die gesetzliche Gleichheit werden als wesentliche Bestandteile dieser Freiheit dargestellt.
- Die verfassunggebende Gewalt liegt beim Volk, das als souveräne Instanz betrachtet wird. Dieses Volk hat die „hervorbringende Gewalt“ (pouvoir constituant), um die Grundordnung des Staates zu schaffen.
- Sobald diese Grundordnung etabliert ist, wird die verfassungsgebende Gewalt in „verfasste Gewalt“ (pouvoir constitué) überführt, also in die Institutionen und Organe des Staates, die die Verfassung umsetzen und wahren.
Im Shop der von der Bundeszentrale für politische Bildung betrieben wird, wurde unter Zeitschriften in der Rubrik "Herrschaft des Rechts" den Artikel Selbstbindung durch Recht im demokratischen Verfassungsstaat veröffentlicht und aus Verständnisgründen zitiert:
Begrenzung des Handlungsspielraums als Schutz vor Gefahr und Ermöglichung von Handlungen, die ohne dies nicht möglich wären – das sind auch die beiden zentralen Wirkungen, die die Bindung des Souveräns an eine Verfassung beinhaltet. ... Damit diese Bindung nicht schon bei der ersten Versuchung wieder gelöst wird, bedarf es für die Verfassung einer besonderen Bestandsgarantie: Sie wird als Recht zweiter Ordnung konzipiert, das gegenüber dem Recht erster Ordnung höherrangig ist. Hervorgebracht werden kann es nur aufgrund eines besonderen Willensentschlusses des Volkes, das sich mit diesem Recht selbst binden will, und geändert werden kann es nur unter erschwerten Bedingungen qualifizierter Mehrheitserfordernisse.
Die Verfassung bewirkt also die Bändigung einer – vermeintlichen oder tatsächlichen – Irrationalität, die sich in politischer Macht Bahn brechen und für die Freiheit des Einzelnen wie auch für das Gemeinwohl zur Gefahr werden kann. Dass solche Gefahren auch der Demokratie drohen, wenn das Volk mit Mehrheit entscheidet, ist eine der zentralen Erfahrungen der politischen Moderne, weshalb auch diese Herrschaftsform auf institutionelle Sicherungsmaßnahmen zur Kontrolle von Machtausübung und Begrenzung ihrer Verfügungsgewalt angewiesen ist. Das ist der Sinn vielerlei Vorkehrungen im Verfassungsstaat, angefangen bei der Differenzierung zwischen dem Innehaben und dem Ausüben der Staatsgewalt: Die Staatsgewalt geht vom Volk aus, es bildet die – unter der normativen Prämisse gleicher Freiheit einzig überzeugende – Legitimationsquelle, aber ausgeübt wird die Staatsgewalt durch eigens eingesetzte Regierungsinstitutionen, für die Repräsentanten in periodisch wiederkehrenden Wahlen bestimmt werden. Die gewählten Repräsentanten üben ihr Wahlmandat im Rahmen eines Amtes aus – das heißt, ihre Handlungsvollmacht ist erstens eine übertragene und zweitens eine rechtlich begrenzte, die drittens inhaltlich durch die aufgegebene Ausrichtung am Gemeinwohl bestimmt ist. Viertens sind die gewählten Amtsinhaber denen gegenüber, die sie repräsentieren, für ihre Tätigkeit politisch verantwortlich.
Die Unterscheidung zwischen Innehaben und Ausüben der Staatsgewalt drückt sich auch in der Lehre der verfassunggebenden Gewalt aus, wonach das Volk als Souverän die die Verfassung "hervorbringende Gewalt" ist (pouvoir constituant) und in ihrem Rahmen als "verfasste Gewalt" (pouvoir constitué) handelt. Die Souveränität im Verfassungsstaat wird durch diese umfassende Verrechtlichung, die selbst den verfassungsändernden Gesetzgeber miteinschließt, latent. Für eine Kontrolle der Regierungsinstitutionen untereinander soll die horizontale Gewaltenteilung beziehungsweise -verschränkung sorgen, sodass keine der jeweiligen Institutionen die rechtlich umgrenzten Kompetenzen überschreitet und über die begrenzten Aufgabenbereiche hinausgeht. Die Rechtsbindung aller staatlichen Gewalt bildet im Verfassungsstaat damit nicht nur eine hehre Norm, sondern wird auch durch die Praxis eingeholt. Das gilt vor allem auch für die Grundrechte der Einzelnen, die neben der Gewaltenteilung wohl die wichtigste Sicherungsmaßnahme darstellen, mit der das Prinzip der Rechtsbindung aller staatlichen Gewalt eingelöst wird. Voraussetzung für die Geltung des grundrechtlichen Anspruchs ist die Rechtswegegarantie und eine unabhängige Rechtsprechung. Die Grundrechte begrenzen den Verfügungsbereich der Politik und richten zugleich den Inhalt in eine bestimmte Richtung aus. Sie verlangen nicht nur ein Unterlassen des Staates, sondern auch ein Tun, da der Bereich, den die Grundrechte schützen, nicht nur durch ein Zuviel an staatlicher Politik bedroht sein kann, sondern auch durch ein Zuwenig. Denn ein staatliches Tun ist dann erforderlich, wenn die Freiheitssphären Einzelner konfligieren und eine rechtlich faire Abgrenzung vonnöten ist, damit nicht andernfalls im "freien" gesellschaftlichen Spiel der Kräfte das (vermeintliche) Recht des Stärkeren handlungsleitend ist.
Siehe hierzu auch:
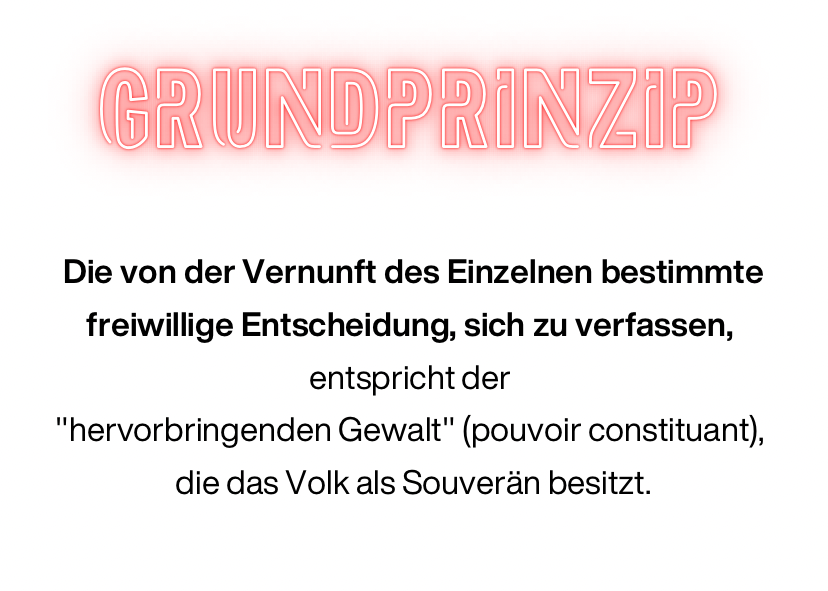
Staatsvertrag, nach Rousseaus Lehre ist ein Gesellschaftsvertrag — „Contrat social“ nach der 1762 erschienenen gleichnamigen staatsphilosophischen Schrift des frz. Schriftstellers u. Kulturphilosophen J.-J. Rousseau (1712–1778)] (Staatsphilos.)
freiwillige, von der Vernunft bestimmte Übereinkunft, durch die der Wille des Einzelnen dem Willen der Allgemeinheit untergeordnet bzw. mit ihm in Einklang gebracht wird.
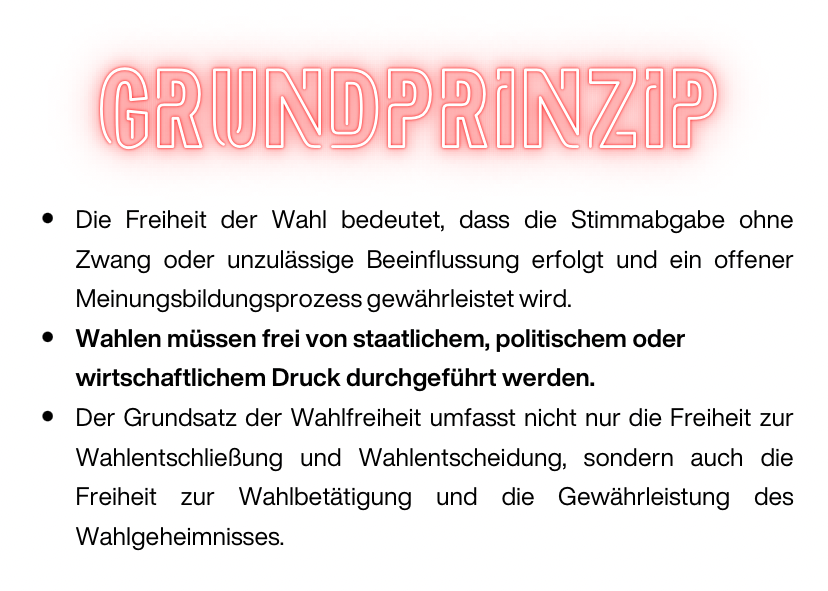
Das Recht der „hervorbringenden Gewalt“ (Souverän) kann von einer „verfassten Gewalt“ (pouvoir constitué) nicht entzogen werden. Um von einer freien Wahl ausgehen zu können muss der vorherige Meinungsbildungsprozess offen sein um zu einer auf Vernunft basierenden Entscheidung kommen zu können, die durch die Abgabe der Stimme zu Ausdruck gebracht wird. Wahlen müssen ohne Zwang, unzulässige Beeinflussung, staatlichen, politischen oder wirtschaftlichen Druck stattfinden.
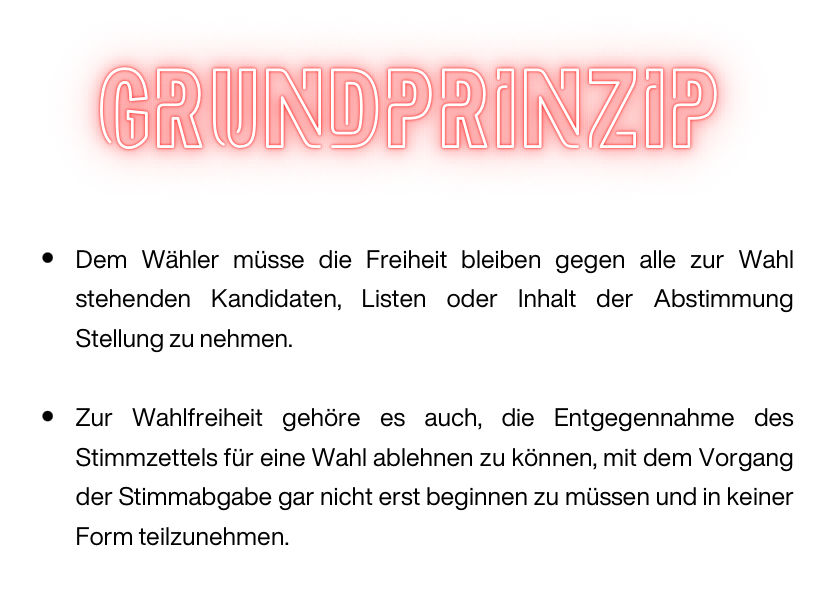
Mittels dem allgemeinen Willen (»volonté générale«) kann eine komplexe Gesellschaft/Gemeinschaft ohne eine ausgeprägte staatliche Organisation und soziale Stratifikation konstituiert werden.
Eine "verfasste Gewalt" (pouvoir constitué) kann eine Änderung ihrer Verfasstheit nicht verhindern (unmöglich machen), ohne gegen die Prinzipien der eigen Befugnis zu verstoßen.


Kritik an der Aussage von Norbert Bolz:
Das System, mit dem wir leben und mit dem wir gut leben und das wir nicht anders haben wollen, das hat drei Stützen: Das ist einmal Demokratie, also die politische Form, wie wir zusammenleben, wie wir Macht organisieren, wie wir unser gesellschaftliches Leben politisch organisieren ...
Ist "das System, mit dem wir leben und mit dem wir gut leben und das wir nicht anders haben wollen" nur mittels Zwang aufrecht zu erhalten oder ist Herrschaft als Organisation von Macht allein von der Möglichkeit zur Ausübung von Gewalt abhängig?
"Das vermeintliche Recht zu herrschen, gleich in welchem Ausmaß oder welcher Form, steht im Widerspruch zur Menschlichkeit. Gewaltausübung ist unvereinbar mit harmonischem Zusammenleben. Das Streben nach Macht widerspricht der Liebe zu den Menschen. Auch wenn man Gewalt hinter komplexen Ritualen und widersprüchlichen Rechtfertigungen verbirgt und brutale Unterdrückung als Tugend und Mitgefühl bezeichnet, ändert dies nichts an diesen grundlegenden Tatsachen." — Larken Rose,The Most Dangerous Superstition
Verschiedene Formen der Machtausübung - sei es durch direkte Gewalt, subtilen Zwang, gezielte Manipulation oder vermeintlich legitime Autorität - untergraben das Prinzip des freien individuellen Einverständnisses. Diese Mechanismen der Kontrolle beeinträchtigen die Autonomie des Einzelnen und haben weitreichende negative Auswirkungen auf das soziale Gefüge. Sie schaffen ein Klima der Angst, des Misstrauens und der Unterdrückung, das einer gesunden Entwicklung der menschlichen Gesellschaft im Wege steht.
„Es gibt weder eine Zahnfee noch einen Weihnachtsmann oder ein magisches Wesen namens ‚Regierung', das eine unmoralische Spezies zu moralischem Verhalten bewegen oder eine Gruppe unvollkommener Menschen zu perfektem Funktionieren bringen kann. Der Glaube an eine solche Instanz ist nicht nur sinnlos und wirkungslos, sondern führt zu einer drastischen Zunahme von Konflikten, Ungerechtigkeit, Intoleranz, Gewalt, Unterdrückung und Mord in der menschlichen Gesellschaft." — Larken Rose, The Most Dangerous Superstition
Letztendlich führen diese Formen der Machtausübung zu einer Erosion zwischenmenschlicher Beziehungen, behindern konstruktiven Dialog und hemmen die kollektive Fähigkeit, gemeinsam kreative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Eine Gesellschaft, die auf gegenseitigem Respekt, Verständnis und freiwilliger Kooperation basiert, bietet dagegen ein weitaus größeres Potenzial für nachhaltiges Wachstum und allgemeines Wohlergehen.
Aus Gordon, Uri (2010): "Hier und jetzt", Nautilus in Hamburg (S. 80 f.)
Gewalt kommt zur Anwendung, wenn A sein Ziel erreicht, obwohl B nicht bereit ist, sich zu beugen, indem A B der Möglichkeit beraubt, zwischen Einwilligung und Nicht-Einwilligung zu wählen. (A will, dass B das Gebäude verlässt, also drängt er oder sie B physisch durch die Tür.)
Zwang wird ausgeübt, wenn B in Reaktion auf As glaubhafte Androhung einer Vorenthaltung (oder einer Strafe) einwilligt. Angesichts einer negativ ausfallenden Kosten-Nutzen-Abwägung, die durch die Drohung gegeben ist, beugt sich B aus eigenem unfreien Willen. (A richtet eine Waffe auf B und verlangt, dass B das Gebäude verlässt.)
Manipulation ist am Werk, wenn A bei der Mitteilung seiner Wünsche an B bewusst lügt oder Informationen unterschlägt. Dieser willigt ein, ohne den Ausgangspunkt oder die genaue Art der Aufforderung, die A an ihn stellt, zu durchschauen. (A bittet B, die Klingel an der Tür zu überprüfen, und sobald B hinausgetreten ist, schließt A ihn aus.)
Autorität wirkt, wenn B sich As Befehl beugt, weil er davon ausgeht, dass A das Recht hat zu befehlen und er selbst eine entsprechende Pflicht zu gehorchen. (A ist ein Polizist, der B sagt, er solle das Gebäude verlassen, und B gehorcht.) ...
Macht-über ist also auch wirksam, wenn diese Gruppen Werte oder Institutionen schaffen oder fördern, die den Bereich der öffentlichen Wahrnehmung oder Kritik einschränken. Wie Stephen Lukes nachweist, kann "Macht-über" auch ausgeübt werden, indem selbst die ureigensten Bedürfnisse der Menschen beeinflusst, geformt, bestimmt werden und durch die Kontrolle ihrer Gedanken und Wünsche ihre Einwilligung gewonnen wird.
"Ihr bezeichnet euch als Christen, Juden oder Anhänger einer anderen Religion, doch in Wahrheit ist das, was ihr eure Religion nennt, bloße Augenwischerei. Was ihr wirklich anbetet, der Gott, vor dem ihr euch tatsächlich verneigt, woran ihr wahrhaftig glaubt, ist der Staat. 'Du sollst nicht stehlen.' 'Du sollst nicht töten.' Es sei denn, du kannst es im Namen der Regierung tun. Dann ist es plötzlich in Ordnung, nicht wahr?"
— Larken Rose, The Iron Web
Grundprämissen als Vorraussetzung
für einen Beitritt zum neuen Gesellschaftsvertrag:
Auf das Gewissen zu hören ist die zu treffende Entscheidung, basierend auf dem freien Willen, sich für die ethisch richtige Handlung zu entscheiden und nicht für die moralisch falsche. Wenn ein Individuum erst das die unumstößliche Überzeugung und endgültiges Wissen über den objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch, gemäß dem Naturgesetz erworben hat, kann dem neuen Gesellschaftsvertrag beigetreten werden.
In einer liberaldemokratischer Gesellschaft trifft eine kleine Minderheit Entscheidungen, die alle betreffen, ohne wirtschaftliche Nachteile befürchten zu müssen. Die Hauptlast tragen diejenigen, deren Einfluss erwiesenermaßen nahezu null ist, da keine Korrelation bei politischen Entscheidungsprozessen messbar ist.
Dieses Obrigkeitssystem zwingt die Bürger, Entscheidungen zu akzeptieren, die sie nicht selbst treffen würden, und behandelt sie wie Untertanen anstelle von Miteigentümern, wie sie es in einer genossenschaftliche Gemeinschaft wären.
Das systemimmanent Problem im Rahmen einer liberaldemokratischen Gesellschaft ist, dass sich innerhalb einer hierarchisch organisierten Gesellschaft immer die Notwendigkeit zur Eindämmung von Machtausübung besteht. Die Notwendigkeit zur Eindämmung von Machtausübung durch die Ausübung eines demokratisch legitimierten Gewaltmonopols lässt den logischen Schluss auf die Untauglichkeit zur Erreichung des Ziels eines gewaltlosen Zusammenleben, zu.
Aller politischen Gewalt wohnt die Tendenz inne, sich schrankenlos auszuwirken und das Gebiet ihres Einflussbereiches soweit als möglich auszudehnen. Alles zu beherrschen, keinen Spielraum zu lassen, in dem sich die Dinge frei ohne Eingreifen der Obrigkeit vollziehen können, das ist das Ziel, dem jeder Machthaber heimlich zustrebt. – Ludwig von Mises, Ökonom
Die meisten großen Übel der Welt sind von wohlmeinenden Menschen verursacht worden. Der Schaden durch gewöhnliche Verbrecher, Mörder, Gangster und Diebe ist vernachlässigbar im Vergleich mit dem Elend, das Menschen durch professionelle Weltverbesserer erleiden, die bereit sind, rücksichtslos ihre Ansichten allen anderen aufzuzwingen, in der unumstößlichen Gewissheit, dass ihr Zweck die Mittel heiligt. – Henry Grady, Journalist
Politik ist ihrem Wesen nach kooperationshemmende Intervention – sie zerstört in jeder Form, die sie annimmt, die Freiheit. Es gibt im Sinne der Freiheit daher keine ‚richtige‘ Politik; freiheitsherstellend und -erhaltend ist nur die konsequente Abstinenz von Politik.
– Rolf W. Puster, Philosoph
Das Gegenteil trifft auf die Tauglichkeit zur Umsetzung des Ziels eines gewaltlosen Zusammenlebens
in einer genossenschaftlichen Gemeinschaft zu:
Eine neue Perspektive auf den Naturzustand
Das Leben bringt für jedes Individuum einen existentiellen, natürlichen Lebensdruck mit sich. Wie unter "Im Grunde gut" ausführlich dargelegt und durch Forschungsarbeitern belegt wurde, werden an dieser Stelle Qualitäten stichwortartig aufgezählt:
- Es besteht eine natürliche Neigung zur Gemeinschaft und zum konfliktvermeidenden Verhalten.
- Menschen sind grundsätzlich gut sind und die gegenteilige Annahme einer egoistischen Natur ist nicht haltbar. Innerhalb von Gemeinschaften sind Kooperation und Empathie vorherrschend.
- Die Evolution der menschlichen Moral basiert auf Kooperation und gemeinsamer Intentionalität, wie Tomasello nachweist. Kooperation und Egalitarismus sind evolutionär verankert und werden durch soziale Normen gefestigt.
- Besonders in Krisenzeiten zeigen Menschen Solidarität statt Chaos.
- Indigene Gesellschaften demonstrieren, wie stabile soziale Normen zu friedlichem Zusammenleben führen können.
Jeder der nicht nur schaut, sondern sehen möchte, kann das offensichtliche erkennen, nämlich, dass die von Acemoglu und Robinson in "Warum Nationen scheitern" gewählten historische Beispiele und Fallstudien, wie Institutionen Wohlstand fördern oder verhindern. Hier kommt das Prinzip der institutionellen Selbstreplikation ins Spiel.
Extraktive Systeme neigen dazu, sich selbst zu verstärken und weiter auszubauen, weil diejenigen, die an der Macht sind, ihre Macht absichern wollen. Sie blockieren oft Reformen oder Innovationen, die die Machtbasis der Elite gefährden könnten. Dies hemmt die wirtschaftliche Dynamik, da neue Ideen und Technologien oft als Bedrohung wahrgenommen werden.
Inklusive Systeme hingegen haben eine eingebaute Dynamik, die gemeinschaftliche und wirtschaftliche Stabilität sowie langfristiges Wachstum begünstigt. Sie fördern den Austausch von Ideen und ermöglichen sozialen Aufstieg durch Innovation und Unternehmertum. Dies sichert nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch politische Stabilität, da die Bevölkerung aktiv am Wohlstand des Landes beteiligt ist und sich damit auch an der Pflege und Weiterentwicklung der Institutionen beteiligt.
„Kooperation beruht auf empathischer Identifikation: Die Teilhabe an den Absichten eines Anderen ist notwendig, um effektiv zusammenarbeiten zu können; dabei lässt man das Ziel des Anderen zur eigenen Angelegenheit werden.“ – Bischof-Köhler 2009: 315
Wenn sich bei einer näheren Betrachtung erschließt, dass diejenigen, die Hauptlast tragen, nicht nur erwiesenermaßen keinen Einfluss auf politische Entscheidungsprozessen haben, sondern sie sich zusätzlich extraktiven Systemen gegeben übersehen, kann mit Fug und Recht von einem parasitären Verhältnis ausgegangen werden.
Aus der Sicht des Wirts wurde in der Vergangenheit die Fragestellung der Legitimität einer solchen Beziehung bereits formuliert:
1789 veröffentlichte Emmanuel Joseph Sieyès Qu’est-ce que le tiers état? (Was ist der Dritte Stand?), ein revolutionäres Pamphlet, das die Legitimität und Struktur der gesellschaftlichen Hierarchie im vorrevolutionären Frankreich in Frage stellte. Sieyès, ein französischer Kleriker und politischer Schriftsteller, argumentierte, dass der „Dritte Stand“ – also die einfachen Bürger, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ausmachten – das eigentliche Fundament der Nation sei. Er stellte die dominierenden Rollen des Adels und Klerus infrage und fragte provokant: „Was ist der Dritte Stand? Alles. Was ist er bisher in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Was will er sein? Etwas.“ "Würde der privilegierte Stand entfernt, wäre die Nation nicht weniger, sondern mehr." Sein Pamphlet forderte eine gerechtere politische Repräsentation und schürte die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Ancien Régime, wodurch er die Französische Revolution mit initiierte.
Am Beginn der Erklärung Menschenrechte und Bürgerrechte (1793) wurden ausdrücklich das Recht die Regierungsakte mit den Zielen von sozialen Institutionen zu vergleichen (sind sie inklusiv oder extraktiv) und sich nicht unterdrücken zu lassen und durch Tyrannei zu erniedrigen.
Das französische Volk war davon überzeugt, dass Vergessen und Missachtung der natürlichen Menschenrechte die einzigen Ursachen für das Leid der Welt sind, und entschlossen, in einer feierlichen Erklärung diese heiligen und unveräußerlichen Rechte zu verkünden, damit alle Bürger in der Lage sind, die Regierungsakte ständig mit dem Ziel einer sozialen Institution zu vergleichen, sich niemals unterdrücken zu lassen und durch Tyrannei zu erniedrigen; damit die Menschen immer vor Augen haben können die Grundlage ihrer Freiheit und ihres Glücks, der Richter von seinen Pflichten geleitet wird und der Gesetzgeber den Gegenstand seiner Mission kennt.
Die Formulierung „der Gesetzgeber den Gegenstand seiner Mission kennt“ im Kontext der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1793 bezieht sich auf die Rolle und Verantwortung des Gesetzgebers im revolutionären Frankreich.
1. Mission des Gesetzgebers:
Der Gesetzgeber hat die Aufgabe, Gesetze im Einklang mit den natürlichen und unveräußerlichen Rechten der Menschen zu schaffen und zu schützen. Diese Rechte, wie sie in der Erklärung von 1793 festgelegt sind, umfassen Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Eigentum.
„Den Gegenstand seiner Mission kennen“ bedeutet, dass der Gesetzgeber sich bewusst sein muss, dass seine oberste Pflicht der Schutz und die Förderung dieser Rechte ist. Seine Tätigkeit soll nicht durch Eigeninteressen oder Machtstreben geleitet sein, sondern durch das Streben nach Gemeinwohl und Gerechtigkeit.
2. Verhältnis zur Volkssouveränität:
Der Gesetzgeber handelt als Repräsentant des souveränen Volkes. Seine Mission besteht darin, den allgemeinen Willen (volonté générale) zu verwirklichen. Er muss die Bedürfnisse und Interessen des Volkes verstehen und umsetzen.
Dies impliziert auch, dass der Gesetzgeber nicht absolute Macht hat, sondern an die Prinzipien der Menschenrechte gebunden ist.
3. Schaffung eines gerechten Rechtssystems:
Die Erklärung von 1793 unterstreicht, dass Gesetze nur dann legitim sind, wenn sie die natürlichen Rechte der Menschen achten und fördern. Der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass er keine Gesetze erlässt, die diese Rechte verletzen oder die Freiheit und Gleichheit der Bürger untergraben.
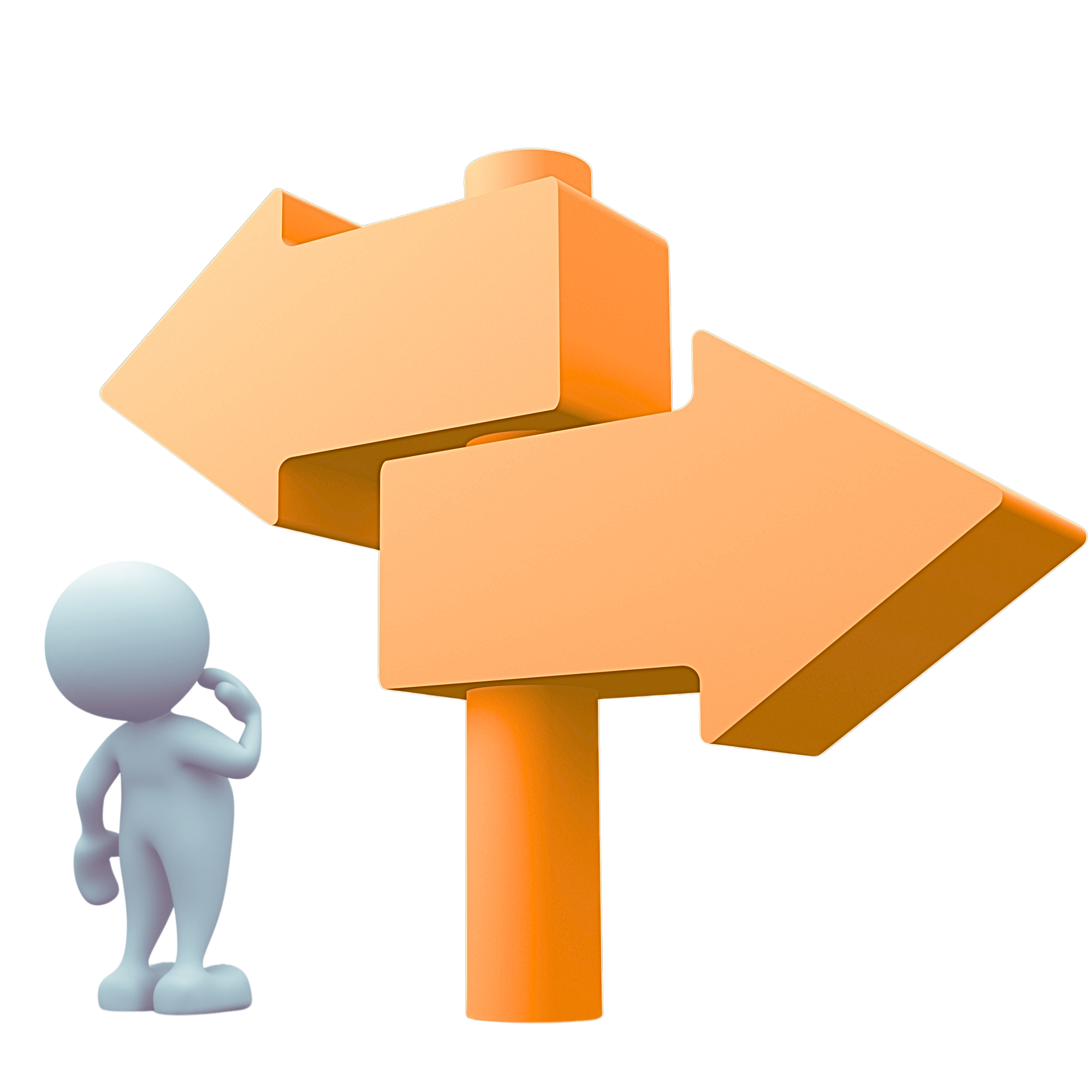
Zwischenfazit
Die Aussage „der Gesetzgeber den Gegenstand seiner Mission kennt“ betont die Notwendigkeit, dass der Gesetzgeber seine zentrale Rolle als Diener der Menschenrechte versteht. Er soll die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit bewahren und die Gesetzgebung im Einklang mit diesen unveräußerlichen Rechten gestalten.
Die Ablösung des absolutistischen Ancien Régime durch Kapitalismus und Demokratie markiert einen fundamentalen Wandel der Moderne. Diese Transformation ging einher mit mehreren wegweisenden Entwicklungen: der Industrialisierung (auch als Industrielle Revolution bekannt), die den Übergang von handwerklicher zu maschineller Massenproduktion einleitete, der Säkularisierung und Aufklärung, sowie dem Fortschrittsglauben - der Überzeugung von unbegrenztem materiellem Wachstum. Hinzu kamen die Rationalität als Vorherrschaft vernunftbasierter Überlegungen, die Autonomie verschiedener gesellschaftlicher Bereiche (Ethik, Politik, Recht, Wirtschaft, Kunst und Literatur) und die Individualisierung als Entwicklung hin zum westlichen Individualismus.
Der westliche Individualismus wurde maßgeblich durch verschiedene historische Entwicklungen geprägt: die Industrielle Revolution in England, den Wirtschaftsliberalismus, die Amerikanische Unabhängigkeitsbewegung und die Französische Revolution. Es stellt eine Tatsache dar, dass in beiden Fällen die jeweiligen verfassungsgebenden Versammlungen KEIN MANDAT hatten, sondern durch das Tun und Handeln eine neue Ordnung konstituiert wurde.
Die russische Oktoberrevolution leitete eine Modernisierung unter dem Vorzeichen des Kollektivismus ein. Diese kollektivistische Tendenz, die sich später auch im Nationalsozialismus zeigte, markierte das Ende der kulturellen Blütezeit der Moderne in Europa und Nordamerika zwischen den Weltkriegen.
Neben der zeitlichen Dimension sollte auch die räumliche Begrenzung der Moderne betrachtet werden. Auch wenn moderne Einflüsse heute in allen Kulturen festzustellen sind, so ist das beispielsweise in Asien vorherrschende zirkulare Denken dem aus der Bibel herkömmlichen linearen Denken des westlichen Fortschrittsglaubens deutlich entgegengesetzt. Ebenso haben verschiedene Aspekte der Moderne in unterschiedlichem Maße Einzug in anderen Kulturen/Ländern gehalten. Hier wird meist zwischen kultureller, technischer, geistiger (manchmal auch politischer und lebensweltlicher) Moderne unterschieden. Es herrscht kein Konsens darüber, ob bzw. inwieweit diese unterschiedlichen Aspekte langfristig getrennt voneinander existieren können und die Unterschiede im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem politischen Dreieck vs. politischen Kompass, Erkennen von Verzerrungen in der Wahrnehmung von Geschichte und Wendepunkten von Zivilisationen weiter analysiert.
Basierend auf den zuvor diskutierten Grundsätzen
stellt sich nun die zentrale Frage nach der Wahl eines Vorbilds:
Wie sollte ein zukünftiges inklusives System aussehen und welche sinnvollen Regulierungen sind für eine egalitäre Gemeinschaftsordnung erforderlich?
- „Niemand kann einem anderen ein Recht übertragen, das er nicht selbst besitzt" und eine Missachtung dessen, ist unvereinbar mit harmonischen Zusammenleben
- Anspruch aufgrund der Überzeugung nicht mehr politisch sein zu wollen und rechtmäßig „vom Glauben abzufallen zu können“
- Anspruch zur Umsetzung der allgemeinen Rechtsauffassung
- Konstituierung einer egalitären, genossenschaftlichen Gemeinschaft


Member discussion